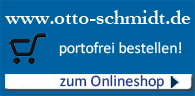BGH v. 24.9.2025 - XII ZB 114/25
Zur Vergütung für die Nutzung eines dem Ehegatten zum alleinigen Gebrauch zuzuweisenden Haushaltsgegenstands
Die Festsetzung einer Vergütung für die Nutzung eines einem Ehegatten für die Trennungszeit zum alleinigen Gebrauch zuzuweisenden Haushaltsgegenstands steht im Ermessen des Gerichts. Ein Sachantrag des zur Überlassung des Haushaltsgegenstands verpflichteten Ehegatten ist für die Festsetzung einer Nutzungsvergütung nicht erforderlich. Eine vorherige Zahlungsaufforderung des zur Nutzung des Haushaltsgegenstands berechtigten Ehegatten ist nicht Voraussetzung für die Festsetzung einer Nutzungsvergütung. Dem Haushaltszuweisungsverfahren ist die Möglichkeit der Festsetzung einer Nutzungsvergütung immanent.
Der Sachverhalt:
Die Rechtsbeschwerde betrifft eine Haushaltssache, welche die Zuweisung eines Pkw und eine hierfür festgesetzte Nutzungsvergütung zum Gegenstand hat. Die Beteiligten sind verheiratet, haben zwei minderjährige Kinder und leben seit Januar 2022 getrennt. Das Scheidungsverfahren ist anhängig. Der verfahrensgegenständliche, im Jahr 2019 gebraucht erworbene Seat Alhambra diente der Familie als - zuletzt einziges - Fahrzeug für alle Alltagsangelegenheiten. Bei ihrem Auszug mit den Kindern nahm die Antragsgegnerin den Pkw einschließlich zweier Kindersitze und eines Fahrradträgers mit. Der Antragsteller, der nach der Trennung zeitweilig ein Fahrzeug von seiner Schwester geliehen hatte, zahlte die Steuern und Versicherungsbeiträge für den streitgegenständlichen Pkw, der inzwischen verschiedene von der Antragsgegnerin verursachte Schäden aufweist, bis zuletzt allein. Im März 2024 wechselten die Kinder in den Haushalt des Antragstellers.
Das AG verpflichtete die Antragsgegnerin, das Fahrzeug einschließlich Ersatzreifen und Fahrradträger an den Antragsteller herauszugeben. Das OLG änderte diesen Beschluss dahin ab, dass dem Antragsteller der Pkw einschließlich Ersatzreifen, Kindersitzen und sämtlichen Schlüsseln sowie der Pkw-Fahrradaufsatz mit Zubehör, insbesondere Schlüsseln und Trägerarm, für die Zeit des Getrenntlebens zum alleinigen Gebrauch zugewiesen und die Antragsgegnerin zur Herausgabe der noch in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände verpflichtet wird. Den Antragsteller verpflichtete das OLG, für die Nutzung des Fahrzeugs beginnend ab dem 1.3.2025 eine mtl. Vergütung i.H.v. 150 € an die Antragsgegnerin zu zahlen und die Kosten für Kfz-Steuer, Haftpflichtversicherung sowie Kfz-Versicherung zu tragen.
Auf die Rechtsbeschwerde des Antragstellers hob der BGH den Beschluss des OLG auf, soweit dem Antragsteller darin aufgegeben worden ist, eine Nutzungsvergütung von mtl. 150 € an die Antragstellerin zu zahlen, und verwies die Sache im Umfang der Aufhebung zur erneuten Behandlung und Entscheidung dorthin zurück.
Die Gründe:
Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, dass die Festsetzung einer vom Antragsteller an die zur Überlassung des Fahrzeugs verpflichtete Antragsgegnerin zu zahlende Nutzungsvergütung von monatlich 150 € im Ergebnis durchgreifenden Bedenken begegnet.
Gem. § 1361 a Abs. 2 BGB werden Haushaltsgegenstände, die den getrenntlebenden Ehegatten gemeinsam gehören, zwischen ihnen nach den Grundsätzen der Billigkeit verteilt. Können sich die Ehegatten nicht einigen, so entscheidet das zuständige Gericht (§ 1361 a Abs. 3 Satz 1 BGB). Dieses kann nach § 1361 a Abs. 3 Satz 2 BGB eine angemessene Vergütung für die Benutzung der zugewiesenen Haushaltsgegenstände festsetzen. Eine vollständige Aufteilung sämtlicher Haushaltsgegenstände ist dabei nicht erforderlich, vielmehr kann eine Nutzungsvergütung auch bei der Zuweisung von einzelnen Haushaltsgegenständen in Betracht kommen. Gerade bei der Zuweisung eines einzelnen umstrittenen Gegenstands kann der Regelung in § 1361 a Abs. 3 Satz 2 BGB dabei Bedeutung zukommen, weil sie dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, einen etwa mit der Zuweisung an einen Ehegatten verbundenen nicht anderweitig kompensierten einseitigen wirtschaftlichen Nutzungsvorteil durch Festsetzung einer angemessenen Vergütung auszugleichen und damit einen anders nicht erzielbaren, der Billigkeit entsprechenden Interessenausgleich zwischen den Ehegatten herzustellen. Zutreffend hat das OLG angenommen, dass es für die Festsetzung einer Nutzungsvergütung nach § 1361 a Abs. 3 Satz 2 BGB keines diesbezüglichen Sachantrags des zur Überlassung des Haushaltsgegenstands verpflichteten Ehegatten bedarf.
Die Annahme des OLG, es bedürfe für die Festsetzung einer Nutzungsvergütung keiner vorherigen Zahlungsaufforderung der zur Überlassung verpflichteten Antragsgegnerin, begegnet ebenfalls keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. In der Literatur und der obergerichtlichen Rechtsprechung wird die Festsetzung einer Nutzungsvergütung allerdings teilweise - jeweils ohne nähere Begründung - an eine vorherige Zahlungsaufforderung des zur Überlassung des Haushaltsgegenstands verpflichteten Ehegatten geknüpft. Dies findet aber weder im Gesetzeswortlaut noch in der Gesetzesbegründung eine Grundlage. Vielmehr geht die Einleitung des Haushaltsteilungsverfahrens aufgrund der Regelung in § 1361 a Abs. 3 Satz 2 BGB immer mit der Möglichkeit einher, dass die Zuweisung mit der Festsetzung einer zu zahlenden Nutzungsvergütung verbunden wird. Dem Haushaltszuweisungsverfahren ist die Möglichkeit der Festsetzung einer Nutzungsvergütung immanent.
Demgegenüber hält die Festsetzung einer Nutzungsvergütung in Höhe von monatlich 150 € im Ergebnis rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Zwar stellt die Rechtsbeschwerde nicht in Abrede, dass der Antragsteller ohne Gefährdung des eigenen Unterhalts und der Erfüllung seiner Unterhaltspflichten in der Lage ist, eine Vergütung für die Nutzung des Fahrzeugs zu zahlen. Zu Recht macht sie allerdings geltend, dass es an den erforderlichen Feststellungen für die Bemessung der Höhe einer vom Antragsteller zu zahlenden Nutzungsvergütung fehlt. Zutreffend nimmt das OLG insoweit noch an, dass sich die Höhe einer angemessenen Vergütung im Ausgangspunkt an der üblicherweise für dem zuzuweisenden Haushaltsgegenstand entsprechende Gegenstände zu zahlenden Miete bzw. dem Nutzwert der konkreten Sache zu orientieren hat, und zwar unter Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten.
Die Rechtsbeschwerde rügt allerdings zu Recht, dass sich der angefochtenen Entscheidung nicht entnehmen lässt, wie hoch das Einkommen des Antragstellers - nach der insoweit gebotenen überschlägigen Betrachtungsweise - ist sowie ob und gegebenenfalls in welcher ungefähren Höhe auch die Antragsgegnerin derzeit Einkünfte erzielt oder zum eigenen Unterhalt einsetzbares Vermögen besitzt. Vor allem hat das Beschwerdegericht nicht mitgeteilt, auf welcher Schätzgrundlage und in welcher Größenordnung es den Nutz- bzw. Mietwert des Fahrzeugs - unter Berücksichtigung seiner konkreten Beschaffenheit wie einer etwa mangelbedingten Gebrauchseinschränkung und den Antragsteller treffenden notwendigen Instandsetzungskosten - angesetzt hat. Eine Beurteilung, ob die vom Beschwerdegericht festgesetzte Vergütung angemessen ist, ist dem Senat auf dieser Grundlage nicht möglich.
Mehr zum Thema:
Kommentierung | FamFG
§ 23 Verfahrenseinleitender Antrag
Ahn-Roth in Prütting/Helms, FamFG, Kommentar, 6. Aufl. 2023
6. Aufl./Lfg. 09.2022
Kommentierung | FamFG
§ 200 Ehewohnungssachen; Haushaltssachen
Neumann in Prütting/Helms, FamFG, Kommentar, 6. Aufl. 2023
6. Aufl./Lfg. 09.2022
Kommentierung | FamFG
§ 203 Antrag
Neumann in Prütting/Helms, FamFG, Kommentar, 6. Aufl. 2023
6. Aufl./Lfg. 09.2022
Kommentierung | BGB
§ 1361a Verteilung der Haushaltsgegenstände bei Getrenntleben
Kroll-Ludwigs in Erman, BGB, 17. Aufl. 2023
09/2023
Aktionsmodul FamRZ Familienrecht
Otto Schmidt Answers ist in diesem Modul mit 5 Prompts am Tag enthalten! Nutzen Sie die Inhalte in diesem Modul direkt mit der KI von Otto Schmidt. Top-Fachzeitschriften: FamRZ und FamRB. Mit zahlreichen Werken der FamRZ-Buchreihe und ausgewählten Handbüchern. Und dem ständig wachsenden Pool von zivilrechtlichen Entscheidungen im Volltext. Inklusive Online-Aktualisierung bei den enthaltenen Kommentaren. 4 Wochen gratis nutzen!