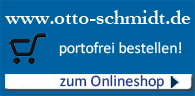BGH v. 7.5.2025 - XII ZB 563/24
Zur Bemessung des angemessenen Selbstbehalts des Unterhaltspflichtigen beim Elternunterhalt
Ordnet das Gesetz in § 94 Abs. 1a Satz 1 und 2 SGB XII an, dass Unterhaltsansprüche gegenüber unterhaltspflichtigen Kindern mit einem Jahreseinkommen von nicht mehr als 100.000 € nicht auf den Träger der Sozialhilfe übergehen, stellt das Sozialhilferecht nicht in Frage, dass auch die durch die Einkommensgrenze privilegierten Kinder ihren Eltern gegenüber zivilrechtlich zum Unterhalt verpflichtet sein können. Es ist dann bereits ein logischer Widerspruch, aus dem gleichen Gesetz die Wertung entnehmen zu wollen, dass der bürgerlich-rechtliche Unterhaltsanspruch der Eltern gegenüber einem privilegierten Kind schon im Vorfeld des Regressverzichts an dessen mangelnder unterhaltsrechtlicher Leistungsfähigkeit scheitern müsste. Überschreitet das unterhaltspflichtige Kind mit seinen Einkünften die Jahreseinkommensgrenze des § 94 Abs. 1a Satz 1 SGB XII, gehen nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes die gesamten Unterhaltsansprüche des unterhaltsberechtigten Elternteils nach § 94 Abs. 1 SGB XII auf den Sozialhilfeträger über, also nicht nur der Teil, der sich auf das über 100.000 € liegende Einkommen des unterhaltspflichtigen Kindes bezieht.
Der Sachverhalt:
Die Antragstellerin macht als Sozialhilfeträgerin gegen den Antragsgegner Elternunterhalt aus übergegangenem Recht geltend. Die Antragstellerin erbrachte der 1937 geborenen Mutter des Antragsgegners (Hilfeempfängerin) für die Zeit von Januar bis Dezember 2020 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII von insgesamt rd. 7.000 €. Der verheiratete Antragsgegner erzielte im Jahr 2020 ein Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit von rd. 118.000 € (mtl. netto rd. 5.800 €). Seine Ehefrau verfügte über ein Einkommen in ähnlicher Größenordnung. Die unterhaltsberechtigte volljährige Tochter lebte im elterlichen Haushalt, einem lastenfreien Einfamilienhaus. Der Antragsgegner hat zwei Geschwister, die von der Antragstellerin nicht auf Unterhalt in Anspruch genommen werden. Die Antragstellerin beantragte, den Antragsgegner für die Zeit von Januar bis Dezember 2020 zur Zahlung von rd. 6.200 € zu verpflichten.
Das AG wies den Antrag ab. Das OLG gab ihm statt und verpflichtete den Antragsgegner antragsgemäß zur Zahlung. Die Rechtsbeschwerde des Antragsgegners hatte vor dem BGH keinen Erfolg.
Die Gründe:
Nach den Feststellungen des OLG lag für den streitbefangenen Unterhaltszeitraum ein den geltend gemachten Unterhalt rechtfertigender Bedarf der Hilfeempfängerin vor, ebenfalls eine entsprechende Bedürftigkeit. Es ist ferner zu Recht davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss des Anspruchsübergangs nach § 94 Abs. 1a SGB XII nicht vorliegen.
Im Ausgangspunkt zutreffend hat das OLG den Selbstbehalt des Antragsgegners ausgehend von der bisherigen Rechtsprechung des Senats ermittelt. Der Umstand, dass der Träger der Sozialhilfe für gewährte Hilfen in den Zeiträumen seit dem Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes am 1.1.2020 keinen Rückgriff auf die durch die Jahreseinkommensgrenze von 100.000 € privilegierten Kinder mehr nehmen kann, hat die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltspflichten von Kindern gegenüber ihren Eltern - als Ausdruck der familiären Beziehungen und Bindungen - unberührt gelassen. Mit seiner Entscheidung, das bürgerliche Unterhaltsrecht nicht zu ändern, hat der Gesetzgeber gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass er die rechtsethische Legitimation des Elternunterhalts weiterhin nicht in Frage stellt und ein berechtigtes Unterhaltsinteresse hilfebedürftig gewordener Eltern anerkennt, welches in einen angemessenen Ausgleich mit den Interessen der unterhaltspflichtigen Kinder zu bringen ist. Die durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz geschaffene Rechtslage zielt nicht auf eine Begünstigung von Angehörigen, welche mit ihren Einkünften die Jahreseinkommensgrenze von 100.000 € überschreiten.
Der Umfang der sozialhilferechtlichen Rückgriffsmöglichkeiten kann dabei schon im Grundsatz nicht unmittelbar dafür maßgeblich sein, welchen Umfang die zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat. Denn der Regress knüpft an das Bestehen eines Unterhaltsanspruchs an, was umgekehrt nicht der Fall ist. Ordnet das Gesetz daher in § 94 Abs. 1a Satz 1 und 2 SGB XII an, dass Unterhaltsansprüche gegenüber unterhaltspflichtigen Kindern mit einem Jahreseinkommen von nicht mehr als 100.000 € nicht auf den Träger der Sozialhilfe übergehen, stellt das Sozialhilferecht nicht in Frage, dass auch die durch die Einkommensgrenze privilegierten Kinder ihren Eltern gegenüber zivilrechtlich zum Unterhalt verpflichtet sein können. Es ist dann bereits ein logischer Widerspruch, aus dem gleichen Gesetz die Wertung entnehmen zu wollen, dass der bürgerlich-rechtliche Unterhaltsanspruch der Eltern gegenüber einem privilegierten Kind schon im Vorfeld des Regressverzichts an dessen mangelnder unterhaltsrechtlicher Leistungsfähigkeit scheitern müsste. Überschreitet das unterhaltspflichtige Kind mit seinen Einkünften die Jahreseinkommensgrenze des § 94 Abs. 1a Satz 1 SGB XII, gehen nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes die gesamten Unterhaltsansprüche des unterhaltsberechtigten Elternteils nach § 94 Abs. 1 SGB XII auf den Sozialhilfeträger über, also nicht nur der Teil, der sich auf das über 100.000 € liegende Einkommen des unterhaltspflichtigen Kindes bezieht. Die weitgehende Unvereinbarkeit zwischen unterhaltsrechtlicher und sozialhilferechtlicher Beurteilung der Zumutbarkeit von Unterhaltszahlungen am Maßstab einer festen Einkommensgrenze könnte faktisch sogar zu einer deutlichen Erhöhung der den Unterhaltsrückgriff ausschließenden Jahreseinkommensgrenze von 100.000 € führen.
Eine Ausrichtung des unterhaltsrechtlichen Mindestselbstbehalts an der Einkommensgrenze des § 94 Abs. 1a Satz 1 SGB XII ist auch nicht geboten, um verfassungsrechtlich bedenkliche Verwerfungen bei der Ungleichbehandlung von Kindern mit steuerrechtlichen Einkünften knapp oberhalb und knapp unterhalb der Jahreseinkommensgrenze von 100.000 € zu vermeiden. Sind die durch die Einkommensgrenze nach § 94 Abs. 1a Satz 1 SGB XII privilegierten Kinder aus der Sicht des Unterhaltsrechts in der Lage, mit ihrem unterhalb des Grenzbetrages von 100.000 € liegenden Bruttoeinkommen zum Unterhalt des hilfebedürftigen Elternteils beizutragen, beschränkt sich die zivilrechtliche Unterhaltspflicht des nicht privilegierten Geschwisterkindes bei einer Mehrzahl von leistungsfähigen Unterhaltspflichtigen der Höhe nach von vornherein auf einen nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB bemessenen Haftungsanteil am gesamten Bedarf des Leistungsberechtigten. Schon der Umstand, dass der unterhaltsrechtlich nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB von den privilegierten Geschwistern geschuldete Unterhaltsanteil nicht dem zum Unterhaltsregress herangezogenen Kind, sondern dem Sozialhilfeträger auferlegt wird, trägt wesentlich zur Vermeidung eines innerfamiliären Streits der anteilig haftenden Geschwister untereinander bei. Schließlich findet eine Ausrichtung der Mindestselbstbehalte an der Einkommensgrenze des § 94 Abs. 1a Satz 1 SGB XII auch in der Rechtsprechung des Senats zum (vermuteten) Verbrauch des Familieneinkommens durch Ehegatten bei besonders guten Einkommensverhältnissen keine Stütze.
Der Senat hält daran fest, dass ein Ausgleich zwischen den Unterhaltsinteressen des hilfebedürftigen Elternteils und dem Interesse des unterhaltspflichtigen Kindes an der Aufrechterhaltung seines berufs- und einkommenstypischen Lebensstandards nur gefunden werden kann, indem der angemessene Eigenbedarf anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles und unter Berücksichtigung der besonderen Lebensverhältnisse, die bei der Inanspruchnahme auf Elternunterhalt vorliegen, ermittelt wird. Das setzt voraus, dass zum einen von den Einkünften des Kindes die vorrangigen Unterhaltsverpflichtungen sowie die - nach den großzügigen Maßstäben des Elternunterhalts - berücksichtigungswürdigen Belastungen und vermögensbildenden Aufwendungen abgezogen werden und dass zum anderen dem Kind von dem auf diese Weise bereinigten Einkommen ein individuell bemessener Betrag belassen wird, der sich aus einem Mindestselbstbehalt und einem Bruchteil des diesen Freibetrag übersteigenden Einkommens zusammensetzt. Auch für Unterhaltszeiträume nach dem Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes am 1.1.2020 bleibt es dabei, dass beim Elternunterhalt durchschnittliche Einkommensverhältnisse den Bezugspunkt für die Bemessung des Mindestselbstbehalts bilden. Der Mindestselbstbehalt kann nicht in einer Weise angehoben werden, dass dies eine weitgehende Nivellierung unterschiedlicher Verhältnisse bei den unterhaltspflichtigen Kindern zur Folge hätte, bei denen es (von sehr wenigen Spitzenverdienern abgesehen) auf die tatsächliche Höhe des Einkommens und auf das Bestehen von vorrangigen Unterhaltspflichten oder sonstigen Verbindlichkeiten praktisch nicht mehr ankommt.
Mehr zum Thema:
Rechtsprechung
§§ 1603 BGB, 94 Ia SGBXII: Angemessener Selbstbehalt im Elternunterhalt [m. Anm. Lies-Benachib, S. 175]
BGH vom 23.10.2024 - XII ZB 6/24
Gudrun Lies-Benachib, FamRZ 2025, 167
Rechtsprechung
Zur Bemessung des angemessenen Elternunterhalts
BGH vom 23.10.2024 - XII ZB 6/24
Jörn Hauß, FamRB 2025, 53
FAMRB0074952
Rechtsprechung
Elternunterhalt, Auskunftspflicht der Unterhaltspflichtigen, § 94 Abs. 1a, § 117 SGB XII
BSG vom 21.11.2024 - B 8 SO 5/23 R
Jörn Hauß / Moritz Härdle, FamRB 2025, 229
FAMRB0079135
Aktionsmodul Familienrecht
Alles zum Familienrecht in einem Modul! In Kooperation mit Otto Schmidt, Gieseking, Wolters Kluwer und Reguvis stehen ausgewählte Kommentare, Handbücher und Zeitschriften in einer Datenbank zur Verfügung. Selbststudium nach § 15 FAO: Regelmäßig mit Beiträgen zum Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle und Fortbildungszertifikat. Beratermodul Familienrechtliche Berechnungen: Unterhalt. Zugewinnausgleich. Versorgungsausgleich. 4 Wochen gratis nutzen!