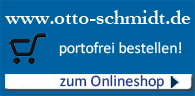BGH v. 28.5.2025 - XII ZB 395/24
Zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen bei Unternehmerehen
Führen Eheverträge bei Unternehmerehen bereits im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu derart einseitigen Lastenverteilungen für den Scheidungsfall, ist ihnen wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung der Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge zu versagen, dass an ihre Stelle die gesetzlichen Regelungen treten (§ 138 Abs. 1 BGB). Sittenwidrigkeit wird regelmäßig nur dann zu bejahen sein, wenn durch den Vertrag Regelungen aus dem Kernbereich des gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts ganz oder jedenfalls zu erheblichen Teilen abbedungen werden, ohne dass dieser Nachteil für den anderen Ehegatten z.B. durch anderweitige Vorteile gemildert oder durch sonstige gewichtige Belange des begünstigten Ehegatten gerechtfertigt wird. Das Verdikt der Sittenwidrigkeit wird in der Regel nicht gerechtfertigt sein, wenn außerhalb der Vertragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen sind, die auf eine subjektive Imparität, insbesondere infolge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer oder wirtschaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller Unterlegenheit, hindeuten könnten.
Der Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten in einem zum Scheidungsverbund anhängig gemachten Zugewinnausgleichsverfahren im Rahmen eines Stufenantrags darüber, ob ein Zugewinnausgleichsanspruch der Antragsgegnerin wirksam durch einen Ehevertrag ausgeschlossen worden ist.
Aus der Beziehung der Beteiligten ging zunächst eine 2008 geborene Tochter hervor. Am 3.12.2010 schlossen die Beteiligten einen notariell beurkundeten Ehevertrag. Darin vereinbarten sie Gütertrennung und modifizierten die gesetzlichen Regelungen zum nachehelichen Unterhalt. Insoweit wurde der Unterhaltsbedarf der Antragsgegnerin - mit einer Wertsicherungsklausel - für mindestens die Hälfte der Ehedauer verbindlich auf mtl. 3.300 € sowie ab einer Ehedauer von vier Jahren auf mtl. 5.000 € festgeschrieben. Zugleich wurde vereinbart, dass im Falle eines Betreuungsunterhalts bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres des jüngsten gemeinsamen Kindes eine Erwerbsverpflichtung der Antragsgegnerin nicht bestehe. Zum Versorgungsausgleich wurde keine Regelung getroffen. Die Beteiligten vereinbarten aber einen gegenseitigen Verzicht auf das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht. Zudem beinhaltete der Ehevertrag eine salvatorische Klausel.
Am 10.12.2010 schlossen die Beteiligten die Ehe. Während der Ehe wurden (in den Jahren 2012, 2014 und 2016) drei weitere Kinder geboren. Der Scheidungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 19.3.2021 zugestellt. Die Antragsgegnerin, die im Jahr 2006 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hatte, war ab Januar 2007 als Unternehmensberaterin tätig. Bei Abschluss des Ehevertrages war sie Geschäftsführerin einer GmbH mit einem Einkommen von mtl. 4.200 € brutto. Diese Tätigkeit setzte sie - mit einer Unterbrechung von 16 Monaten bei der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes - bis Anfang August 2014 fort. Der Antragsteller ist als Gesellschafter an verschiedenen Unternehmen seiner Familie beteiligt und dort teilweise auch als Geschäftsführer tätig. Die Gesellschaftsverträge sehen vor, dass jeder Gesellschafter mit dem Ehegatten Gütertrennung zu vereinbaren hat.
Das AG entschied durch Scheidungsverbundbeschluss, dass die Ehe geschieden, der Versorgungsausgleich durchgeführt und der Stufenantrag auf Zugewinnausgleich insgesamt abgewiesen wird. Die gegen die güterrechtliche Entscheidung gerichtete Beschwerde der Antragsgegnerin blieb vor dem OLG ebenso ohne Erfolg wie die vorliegende Rechtsbeschwerde vor dem BGH.
Die Gründe:
Das OLG ist zutreffend davon ausgegangen, dass ein Zugewinnausgleich der Antragsgegnerin durch den Ehevertrag der Beteiligten wirksam ausgeschlossen worden ist.
Im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle hat der Tatrichter zu prüfen, ob die Vereinbarung schon im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen Lastenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihr wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung der Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge zu versagen ist, dass an ihre Stelle die gesetzlichen Regelungen treten (§ 138 Abs. 1 BGB). Sittenwidrigkeit wird regelmäßig nur dann zu bejahen sein, wenn durch den Vertrag Regelungen aus dem Kernbereich des gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts ganz oder jedenfalls zu erheblichen Teilen abbedungen werden, ohne dass dieser Nachteil für den anderen Ehegatten z.B. durch anderweitige Vorteile gemildert oder durch sonstige gewichtige Belange des begünstigten Ehegatten gerechtfertigt wird. Das Verdikt der Sittenwidrigkeit wird in der Regel nicht gerechtfertigt sein, wenn außerhalb der Vertragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen sind, die auf eine subjektive Imparität, insbesondere infolge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer oder wirtschaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller Unterlegenheit, hindeuten könnten.
Danach ist es rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden, dass das OLG die Vereinbarung der Gütertrennung im Rahmen der Inhaltskontrolle als wirksam erachtet hat. Es ist zutreffend davon ausgegangen, dass die von den Beteiligten getroffene Vereinbarung der Gütertrennung bei isolierter Betrachtung keinen Wirksamkeitsbedenken unterliegt, weil das Güterrecht nicht dem Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts zuzuordnen ist und der Zugewinnausgleich daher - auch wegen der gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen verschiedenen Güterstände - ehevertraglicher Gestaltung am weitesten zugänglich ist. Dass die Beteiligten eine Unternehmerehe geführt haben, führt zu keiner anderen Beurteilung. Der Senat hat für Unternehmerehen bereits entschieden, dass ein vertraglicher Ausschluss des Zugewinnausgleichs auch dann nicht im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle zu korrigieren ist, wenn bereits bei Vertragsschluss absehbar gewesen ist, dass sich der andere Ehegatte ganz oder teilweise aus dem Erwerbsleben zurückziehen würde und ihm deshalb eine vorhersehbar nicht kompensierte Lücke in der Altersversorgung verbleibt.
Vielmehr hat der Senat ein überwiegendes legitimes Interesse des erwerbstätigen Ehegatten anerkannt, das Vermögen seines selbständigen Erwerbsbetriebes durch die Vereinbarung der Gütertrennung einem möglicherweise existenzbedrohenden Zugriff seines Ehegatten im Scheidungsfall zu entziehen und damit nicht nur für sich, sondern auch für die Familie die Lebensgrundlage zu erhalten. Das OLG konnte dahinstehen lassen, ob die Regelungen des Ehevertrags insgesamt zu einer einseitigen Lastenverteilung führen, weil es zu Recht eine subjektive Imparität verneint hat. Rechtsfehlerfrei hat das OLG hierzu ausgeführt, es habe für die Antragsgegnerin keine Zwangslage begründet, dass der Antragsteller die Ehe nur unter der Bedingung eines Ehevertrags eingehen wollte, da sie nicht in besonderem Maße auf die Eheschließung angewiesen gewesen sei. Vielmehr sei sie bei Abschluss des Ehevertrags durch ihre berufliche Tätigkeit wirtschaftlich ausreichend abgesichert gewesen. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Berufserfahrung hätten auch gute Aussichten bestanden, nach ihrem Ausscheiden als Geschäftsführerin der GmbH eine vergleichbare Anstellung zu finden.
Unabhängig von der Wirksamkeit der Klauseln in den Gesellschaftsverträgen, die den Antragsteller zur Vereinbarung der Gütertrennung verpflichten, könne nicht von einer subjektiven Imparität ausgegangen werden, weil dem Antragsteller keine Verwerflichkeit zur Last falle. In der Rechtsprechung des BGH sei ein überwiegendes legitimes Interesse an der Sicherung der Lebensgrundlage auch für die Familie selbst unabhängig von entsprechenden Güterstandsklauseln anerkannt. Auch der gegenseitige Erb- und Pflichtteilsverzicht begründe keine subjektive Imparität. Soweit die Antragsgegnerin das Bestehen einer Zwangslage für sich daraus herleiten will, dass der Antragsteller ohne die Unterzeichnung des Ehevertrags die Hochzeit abgesagt hätte und die Antragsgegnerin dadurch aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung einer besonderen Stigmatisierung anheimgefallen wäre, hat das OLG dieses Vorbringen für nicht durchgreifend erachtet. Hiergegen sind aus Rechtsgründen Bedenken nicht zu erheben. Gleiches gilt für die Erwägung, ein die subjektive Imparität begründender Druck folge daraus, dass mit der bei Nichtabschluss des Ehevertrags drohenden Absage der Hochzeit für sie ein gesellschaftlicher Skandal verbunden gewesen wäre. Das OLG weist insoweit darauf hin, dass angesichts der vergleichbaren sozialen Stellungen beider Beteiligten hierdurch keine Disparität mit unterschiedlichen Drucksituationen zum Nachteil der Antragsgegnerin begründet worden sei. Dies ist rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden.
Mehr zum Thema:
Aufsatz
Ehevertragliche Vereinbarungen: Wie weit reicht die Gestaltungsfreiheit?
Göntje Rosenzweig, FamRB 2025, 124
FAMRB0075998
Beratermodul Familienrecht
Otto Schmidt Answers optional dazu buchen und die KI 4 Wochen gratis nutzen! Die Answers-Lizenz gilt für alle Answers-fähigen Module, die Sie im Abo oder im Test nutzen. Enthält den Erman mit online Aktualisierungen: Aktuelle Kommentierung zum Vormundschaftsrecht und Betreuungsrecht! 4 Wochen gratis nutzen!