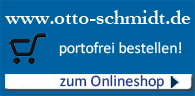OLG München v. 18.6.2025, 2 UF 281/25 e
Unterhaltsanspruch minderjähriger Kinder beinhaltet keine bloße Teilhabe am Luxus der Eltern
Unzutreffend ist das AG davon ausgegangen, dass bei einem Einkommen des barunterhaltspflichtigen, das über dem Höchstsatz der Düsseldorfer Tabelle liegt, eine Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle in Betracht kommt um die Lebensstellung des Kindes, die sich aus der Lebensstellung der Eltern ableitet, aufrecht zu erhalten. Beim Unterhalt minderjähriger Kinder ist zu beachten, dass dieser keine bloße Teilhabe am Luxus der Eltern beinhaltet und naturgemäß erst recht nicht zur Vermögensbildung des unterhaltsberechtigten Kindes dient.
Der Sachverhalt:
Der Antragsgegner ist der Vater der Antragstellerin. Er ist mit der Kindesmutter, bei der diese lebt, nicht verheiratet. Die Eltern üben die elterliche Sorge gemeinsam aus. Die Antragstellerin besucht derzeit die Schule und verfügt über kein eigenes Einkommen. Der Antragsgegner hatte 2024 an die gesetzliche Vertreterin der Antragstellerin monatlich 1.165 € überwiesen. Im Jahr 2023 waren es 1.004 €. Dies entspricht 200% des Mindestunterhalts der Düsseldorfer Tabelle der 3. Altersklasse abzüglich hälftigem Kindergeld. Zudem trägt er die Kosten für die Schule und die Verpflegung in der Schule. Der Antragsgegner erklärte, dass er zur Zahlung von Kindesunterhalt unbegrenzt leistungsfähig sei und über ein monatliches Nettoeinkommen von mind. 50.000 € verfüge. Er hat zudem erklärt, die Kindsmutter von jeglichem Haftungsanteil für angemessenen Mehr- und Sonderbedarf bis zur Volljährigkeit der Antragstellerin freizustellen.
Die Antragstellerin machte im Rahmen einer Stufenklage zuletzt einen Auskunftsanspruch über das Einkommen des Antragsgegners und die Vorlage von entsprechenden Belegen geltend. Sie war der Ansicht, einen umfassenden Auskunftsanspruch zu haben, weil hierfür die Möglichkeit ausreiche, dass die Auskunft Einfluss auf den Unterhalt haben könne. Der Antragsgegner war der Ansicht, dass ihr ein umfassender Auskunftsanspruch nicht zustehe, weil sein Gesamteinkommen für den der Antragstellerin zustehenden Unterhaltsanspruch unter keinem Gesichtspunkt von Bedeutung sein könne.
Das AG hat den Antragsgegner mit Teilbeschluss verpflichtet, der Antragstellerin Auskunft über sein gesamtes Einkommen zu erteilen und Belege hierzu vorzulegen. Beim Kindesunterhalt bestimme sich die nach § 1610 Abs. 1 BGB maßgebliche Lebensstellung des bedürftigen Kindes nach der Lebensstellung seiner Eltern. Diese werde in erster Linie von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern geprägt. Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde des Antragsgegners hat das OLG den Beschluss des AG aufgehoben und den Antrag der Antragstellerin auf Auskunftserteilung zurückgewiesen.
Die Gründe:
Anders als das AG geht der Senat davon aus, dass bei den vorliegenden Gegebenheiten und Erklärungen des Antragsgegners kein – auch kein konkreter – zusätzlicher Bedarf des Kindes denkbar ist, der sich aus einem Nettoeinkommen des Antragsgegners von mehr als 50.000 € pro Monat ergeben kann und der nicht als Luxus oder Vermögensbildung anzusehen ist, woran das Kind im Rahmen des Unterhalts kein Teilhaberecht hat.
Unzutreffend ist das AG davon ausgegangen, dass bei einem Einkommen des barunterhaltspflichtigen, das über dem Höchstsatz der Düsseldorfer Tabelle liegt, eine Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle in Betracht kommt um die Lebensstellung des Kindes, die sich aus der Lebensstellung der Eltern ableitet, aufrecht zu erhalten. Es hat sich auf eine Entscheidung des OLG München vom 10.10.2019 bezogen und dabei verkannt, dass diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt ergangen war, zu dem die Einkommenshöchstgrenze nach der Düsseldorfer Tabelle 5.500 € betrug und damit auch nach Ansicht des BGH in seiner Entscheidung vom 16.9.2020 (XII ZB 499/19) nicht mehr Gewähr dafür bot, dass die von den Eltern abgeleitete Lebensstellung des Kindes bei hohen Einkommen angemessen dargestellt wird.
Eine über die höchste Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle hinausgehende Fortschreibung der Tabellenwerte hat der Senat in seiner bisherigen Rechtsprechung nicht für sachgerecht gehalten und bei hohen Einkommen stattdessen grundsätzlich eine konkrete Bedarfsermittlung verlangt. Daran hält der Senat jedoch nicht mehr uneingeschränkt fest. In seiner neueren Rechtsprechung zum Ehegattenunterhalt hat der Senat auch für ein über den höchsten Tabellenbetrag der Düsseldorfer Tabelle hinausgehendes Familieneinkommen eine Ermittlung des Unterhaltsbedarfs nach der ebenfalls schematischen Quotenmethode ohne konkrete Bedarfsermittlung zugelassen.
Da Kinder grundsätzlich am Lebensstandard der Eltern teilnehmen, soweit sie ihre Lebensstellung von diesen ableiten, muss Ähnliches auch für den Kindesunterhalt gelten. Der Senat hat schon in seiner bisherigen Rechtsprechung klargestellt, dass auch bei höherem Elterneinkommen sichergestellt bleiben muss, dass Kinder in einer ihrem Alter entsprechenden Weise an einer Lebensführung teilhaben, die der besonders günstigen wirtschaftlichen Situation ihrer Eltern entspricht, und der Kindesunterhalt auch bei einem den höchsten Einkommensbetrag übersteigenden Elterneinkommen im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweislast des Unterhaltsberechtigten für seinen Unterhaltsbedarf nicht faktisch auf den für die höchste Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle geltenden Richtsatz festgeschrieben werden darf.
Allerdings ist insbesondere beim Unterhalt minderjähriger Kinder zu beachten, dass dieser keine bloße Teilhabe am Luxus der Eltern beinhaltet und naturgemäß erst recht nicht zur Vermögensbildung des unterhaltsberechtigten Kindes dient. Schließlich ist das Maß des den Kindern zu gewährenden Unterhalts auch maßgeblich durch das „Kindsein“ geprägt, berechtigt also insbesondere nicht zu einer gleichen Teilhabe am Elterneinkommen. Diese mit dem Kindesunterhalt verbundenen Grenzen werden indessen durch eine an der neueren Rechtsprechung des Senats zum Ehegattenunterhalt ausgerichtete Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle noch nicht berührt. Im Vergleich zum Ehegattenunterhalt beinhalten die in der Düsseldorfer Tabelle enthaltenen Steigerungssätze schon keine quotenmäßige (lineare) Beteiligung am Einkommen des Unterhaltspflichtigen.
Vielmehr sind die Unterhaltssteigerungen jeweils am Mindestunterhalt orientiert und führen im Zusammenhang mit der Bemessung der Einkommensgruppen dazu, dass die Beteiligungsquote am Elterneinkommen (degressiv) stetig abnimmt. Eine dieses beibehaltende (und gegebenenfalls mit größer dimensionierten Einkommensgruppen versehene) Fortschreibung würde dementsprechend nur zu moderaten einkommensabhängigen Steigerungen des Kindesunterhalts führen. Daneben bleibt dem unterhaltsberechtigten Kind die konkrete Darlegung eines höheren Bedarfs unbenommen.
Mehr zum Thema:
Aufsatz
Entwicklungen im europäischen Personen-, Familien- und Erbrecht 2023-2024
Christian Kohler / Walter Pintens, FamRZ 2024, 1413
Aktionsmodul Familienrecht
Alles zum Familienrecht in einem Modul! In Kooperation mit Otto Schmidt, Gieseking, Wolters Kluwer und Reguvis stehen ausgewählte Kommentare, Handbücher und Zeitschriften in einer Datenbank zur Verfügung. Selbststudium nach § 15 FAO: Regelmäßig mit Beiträgen zum Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle und Fortbildungszertifikat. Beratermodul Familienrechtliche Berechnungen: Unterhalt. Zugewinnausgleich. Versorgungsausgleich. 4 Wochen gratis nutzen!